Wenn sich der Polizeichef langweilt
Für viele, viele Jahre gehörte Petros Markaris zu meinen Lieblingsautoren. Kaum ein Kreta-Urlaub verging ohne den neuesten Kriminalroman von ihm im Gepäck. Wer das aktuelle Griechenland verstehen wollte, der war bei ihm bestens aufgehoben. Den ganzen griechischen Salat, die korrupten Manager, die unfähigen Vorgesetzten, die Mafiosi, die Albaner, die auf den Baustellen ausgebeutet wurden, servierte er mit leichter Hand.
Wut und Not während der Finanzkrise
Selbst als die Fälle zur Nebensache wurden, konnte ich nicht von seinen Büchern lassen. Wichtiger als die Aufklärung eines Mordes wurde dem engagierten Schriftsteller während der Finanzkrise, die Not und die Wut seiner Landsleute festzuhalten. Der übergewichtige Kommissar Charitos und seine Frau, seine Tochter und sein Schwiegersohn standen stellvertretend für alle, die plötzlich nicht mehr wussten, wie sie ihre Familie ernähren sollten und die zusammenrückten.
Symphatie gehört den Schwachen
Markaris machte nie einen Hehl daraus, dass seine Sympathie den Schwachen gehört. Der Autor selbst ist in mehreren Welten zu Hause. Geboren wurde er 1937 in Istanbul. Seine Mutter war Griechin, sein Vater ein Armenier, der Geschäfte mit Österreich machte und seinen Sohn deshalb nach Wien schickte. Der Sprössling interessierte sich allerdings nicht für den Im- und Export. Er verliebte sich - in die deutsche Sprache, übersetzte Goethe und Brecht ins Griechische. Doch er wollte auch selbst schreiben, verfasste zunächst Theaterstücke, später dann Drehbücher. „In meinem Leben habe ich stets das getan, was ich nicht tun wollte“, stellt er in seinem autobiografischen Essay „Wiederholungstäter“ fest. Aber, fährt er selbstbewusst fort, das mache er bestens.
Seit 1996 ermittelt Kommissar Kostas Charitos
Das stimmte so über viele Jahre. 1996, da war der Autor bereits 58 Jahre alt, erblickte Kommissar Charitos das Licht der Welt. Wichtiger als die geschickt verwobene Krimi-Handlung waren dem Schriftsteller schon damals die lebensprallen Figuren.
An erster Stelle steht da selbstverständlich der kauzige Ermittler, aus dessen Perspektive erzählt wird. Charitos ist ein Durchschnittsbürger, der Neuerungen jeglicher Art erst einmal skeptisch gegenübersteht. Buch um Buch wuchs einem der wortkarge Vielfraß ans Herz. „Hellas Channel“, „Nachtfalter“, „Live!“, „Balkan Blues“, „Der Großaktionär“ und „Die Kinderfrau“ heißen die besten Roman-Verbrechen, die der Griesgram im Diogenes Verlag aufgeklärt hat.
Charitos sitzt jetzt meist im Büro
Nun muss er wieder ran, doch in seinem neuesten, seinem 15., Fall nicht als ermittelnder Kommissar, sondern als Polizeichef von Athen. In „Aufstand der Frauen“ rast er nicht mehr zu den Tatorten, sondern sitzt meist im Büro. Die Beförderung hat so ihre Tücken. Denn Charitos langweilt sich und mit ihm die Leser. Und wahrscheinlich auch der Autor. Anscheinend hat auch der 87-Jährige keine große Lust gehabt, starke, unverwechselbare Charaktere zu entwickeln. Selbst liebgewordene Figuren enttäuschen. Unser Griesgram ist ein echter Menschenfreund geworden, liebt seine Frau, mit der er früher immer stritt - zur Versöhnung gab es gefüllte Tomaten -, seine Tochter, seinen Schwiegersohn und seinen Enkel - eigentlich die ganze Welt. Natürlich auch seine Nachfolgerin bei der Mordkommission, die er zu sich nach Hause einlädt und wo dann Adriani das einzige Mal im Buch gefüllte Tomaten auftischt.
Der Autor mag einfache, kurze Sätze
Doch literarisch ist heute Schmalhans Küchenmeister. Der Autor mag einfache, kurze Sätze. Dagegen wäre ja nichts zu sagen, wenn nicht unser Held immer die gleichen Tätigkeiten ausführen würde. Wir erleben den Kommissar, wie er seine Untergebenen in sein Büro bittet, mit seinen Vorgesetzten konferiert, mit seiner Familie zusammenkommt - ein alltägliches Allerlei.
Spannende Handlung? Fehlanzeige!
Eine spannende Handlung - Fehlanzeige. Der neue Polizeichef bewegt sich von A nach B, dabei vermerkt der Autor akribisch, ob er im Stau steht oder nicht. Wie Athen aussieht, das Markaris früher so anschaulich beschrieben hat, erfahren wir nicht.
Er wollte, so hat Markaris im Interview mit dem Deutschlandfunk verraten, über die Gewalt schreiben, die Frauen erleben. Doch das Beispiel, das er wählt, ist arg konstruiert. Junge Archäologinnen, die sich die Karyatiden - nach Frauenfiguren in der Antike - nennen, protestieren gegen amerikanische Investoren, die eine Art antikes Disneyland planen. Daraufhin ziehen sich die Geldgeber zurück und zwei von den Demonstrantinnen werden umgebracht. Ein dritter Fall hat damit nur am Rande zu tun.
Leckeres Essen im Obdachlosenheim
Einen klitzekleinen Trost gibt es: Adriani, die bisher nur am heimischen Herd wirkte, emanzipiert sich - jedenfalls ein bisschen. Sie kocht nun im Obdachlosenheim. Auch dort gibt es leckeres Essen. Nur leider bekommt unser Dickerchen davon neuerdings Bauchgrimmen. Den Lesern ist nach der Lektüre ebenfalls ein wenig flau im Magen, sie hungern nach besserem Lesefutter. (tra)
Petros Markaris: „Aufstand der Frauen“, Diogenes-Verlag, 25 Euro

© Griechisches Kulturministerium/dpa
Die Demonstrantinnen in dem Krimi benennen sich nach den Karyatiden, meist überlebensgroße Frauenfiguren, die die in der antiken Architektur eine tragende Funktion hatten. Sie stützten Dächer oder Giebel.
Zum Weiterlesen
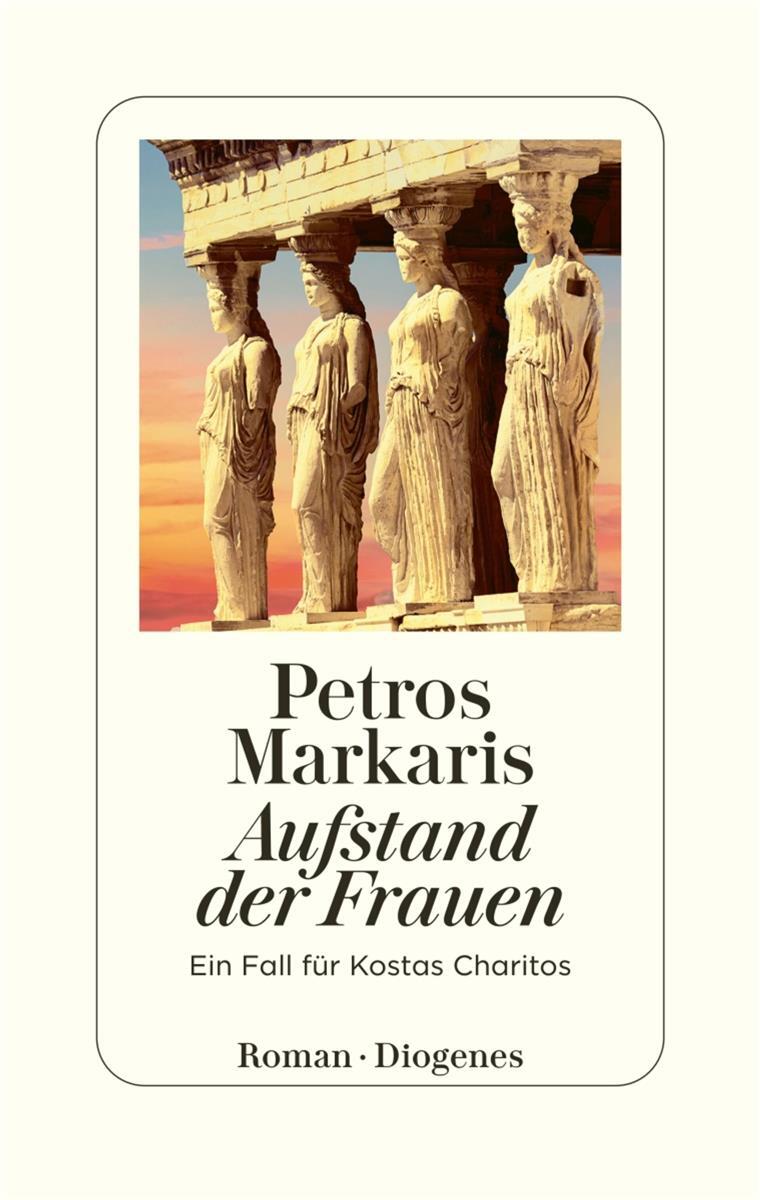
© pr
Cover von Petros Markaris „Aufstand der Frauen“

