Wenn Propaganda die Familie spaltet
Dmitrij Kapitelmans drittes Buch „Russische Spezialitäten“, das er während der Jüdischen Kulturtage im Stadttheater Bremerhaven vorstellt, ist vielleicht das düsterste Buch, das er bisher geschrieben hat. Lachen hilft da nur bedingt, auch wenn es immer noch ein probates Mittel ist, den Wahnsinn, der sich fast überall in der Welt ausbreitet, auszuhalten.
Autor verknüpft das Private mit dem Politischen
Der Roman trägt autobiografische Züge. „Der Ich-Erzähler ist eigentlich am uninteressantesten“, findet der Mann mit den vielen Identitäten: ukrainisch, russisch, jüdisch und deutsch. Einspruch, werter Autor. Denn wie der 1986 in Kiew geborene Kapitelman, der mit acht Jahren nach Deutschland kam, die Welt beschreibt, bringt uns die gesellschaftlichen Widersprüche nahe. Und zeigt auf, wie fragil Identität ist. Der 39-Jährige verknüpft in seinem Buch „Russische Spezialitäten“, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, das Politische mit dem Privaten, nimmt uns erst einmal mit in den ukrainisch-moldawisch-jüdischen Lebensmittelladen seiner Eltern in Leipzig, dem Magasin.
Dort kommt zwar fast niemand aus Russland, aber alle sprechen russisch, die Stammkunden ebenso wie die Betreiber, die Eltern Kapitelman. Sie handeln mit russischen Spezialitäten, mit Krimsekt und Mineralwasser aus Myrhorod, Kaviar und Flusskrebsen in Tomatensoße und, und und. „All diese Dinge waren etwas Vertrautes, Verständliches und Eigenes.“ Die nun in Deutschland lebenden Osteuropäer erstehen nicht nur gezuckerte Kondensmilch, sondern sie kaufen Nostalgie, halten so die Erinnerung an die alte Heimat in einem feindlichen Umfeld hoch.
Als Russland die Ukraine überfällt, ist es mit dieser Idylle vorbei - vor allem innerhalb der Familie. Die Mutter, die nur ihre ersten drei Jahre in Sibirien gelebt hat, glaubt alles, was die russische Propaganda verkündet, ist gefangen im „Fernseh-Russland“. Dabei nimmt sie sogar in Kauf, dass alte Freundschaften zerbrechen. „Die Ukrainer zerstören das Land“, knurrt sie.
Im Bunker bei Bombenalarm
Der Ich-Erzähler verzweifelt an ihrem russischen Starrsinn. Deshalb reist er in die Ukraine in der vergeblichen Hoffnung, die Mutter mit Fakten aus ihrer Parallelwelt zu reißen. Auch Dmitrij Kapitelman ist nach Kiew gefahren, weil er es zu selbstgefällig gefunden hätte, nur aus der Perspektive der Diaspora zu berichten. Die Erfahrungen verarbeitet er im zweiten Teil des Buches: Fahrten nach Butscha und Borodjanka, Gespräche mit Freunden, die täglich damit rechnen, an die Front geschickt zu werden, taucht ein in den Alltag in Kiew. Nicht nur die Szene im Bunker geht unter die Haut. „Es ist wieder Luftalarm in Kiew“, spricht ein kleiner Junge in sein iPad. „Es klingt absurd beiläufig, als hätte es wieder Grießbrei in der Kita gegeben“, schlussfolgert der Autor.
Bei aller Schwere hat Dmitrij Kapitelman ein stellenweise sehr komisches Buch geschrieben, eines, das dem Schrecken oft mit freundlichem Sarkasmus begegnet, einen „Liebespakt mit den Lesern“ nennt der Autor das. Der Humor stellt sich nicht nur über absurde Situationen ein, sondern auch über die Wörter, die der empathische Beobachter neu zusammensetzt wie „zwangsberusst“ oder „Corona-Wir-Russ“.
Tote Fische in der Fischtheke können sprechen
Außerdem flicht der 39-Jährige in die Handlung immer wieder surreale Szenen ein. So können tote Fische in der Fischtheke sprechen, und Menschen verwandeln sich in Zigaretten. Ob das Magie sei, will Moderatorin Viktoria Helene Ong von ihm wissen. „Nein“, antwortet er. Magie sei, wenn man einen Hasen aus dem Hut zaubere. Magischer Realismus, sein Stilmittel, hingegen sei, wenn ein rauchender Hase dem Hut entsteige und von seiner Scheidung erzähle. Er habe diese Elemente eingebaut, um die Frage auszubremsen, ob denn alles wahr sei, was er berichte.
Wahr ist auf jeden Fall, dass Kapitelman seine Mutter, obwohl von ihr „die Kälte des Krieges ausgeht“, immer noch liebt. Und selbstverständlich auch die russische Sprache: „Ich trage eine Sprache wie ein Verbrechen in mir und liebe sie doch, bei aller Schuld.“ Soll man die russische Sprache Putin überlassen? Natürlich nicht. Schon deswegen ist der Roman mit russischen Ausdrücken gespickt, die er, gesteht Kapitelman, nicht immer richtig angewendet habe.
Gibt es Hoffnung? Für Mutter und Sohn vielleicht. Und für alle anderen? Die Kunst, so glaubt Kapitelman, könnte ein Raum sein, der die Menschen zusammenbringt. Ob er an einem neuen Roman arbeite? „Nein, aber ich bin vertraglich dazu verpflichtet.“ Für den Autor erhöht das den Druck, doch für die Leser ist es eine gute Nachricht. Denn Wahrheitsfälschung und autoritäre Gewalt bleibt leider ein hochaktuelles Thema. Und niemand kann das so treffsicher auf den Punkt bringen wie Kapitelman.
Dmitrij Kapitelman: „Russische Spezialitäten“, Roman, Hanser-Verlag, 23 Euro.
Zum Weiterlesen
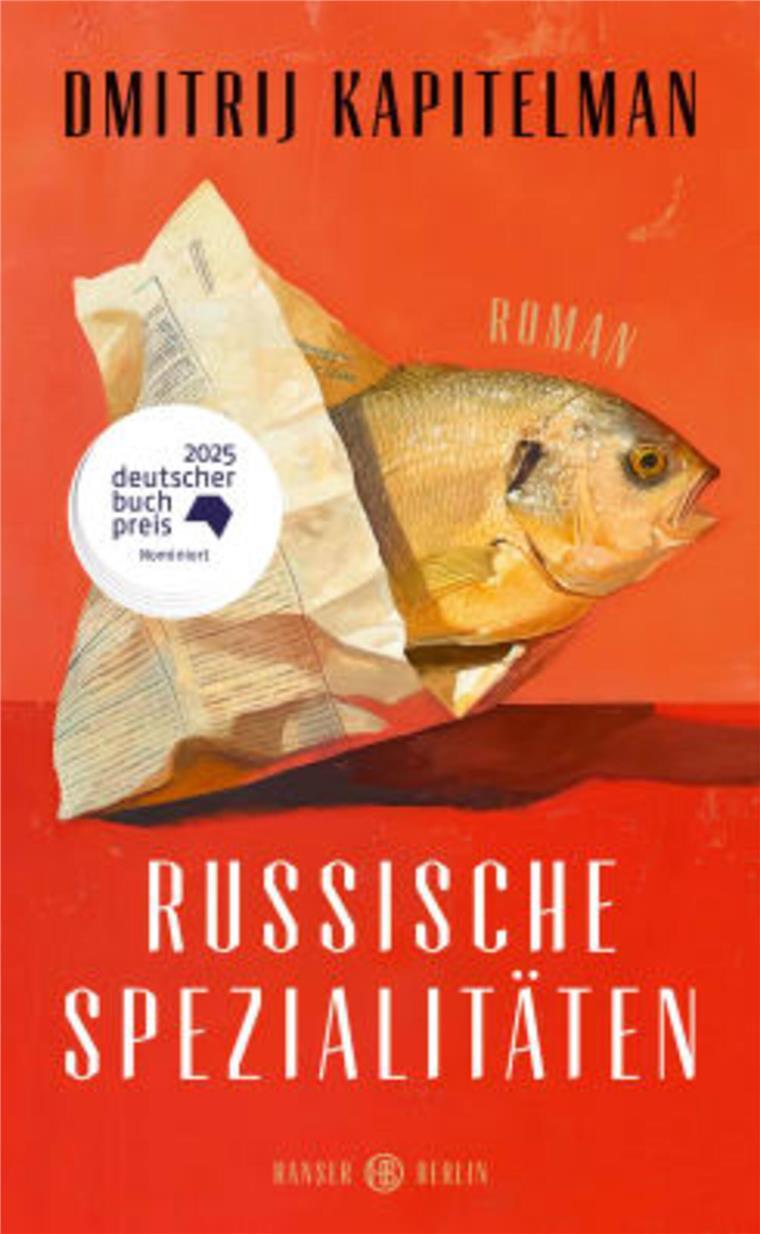
© pr
Der Roman „Russische Spezialitäten“ steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.

